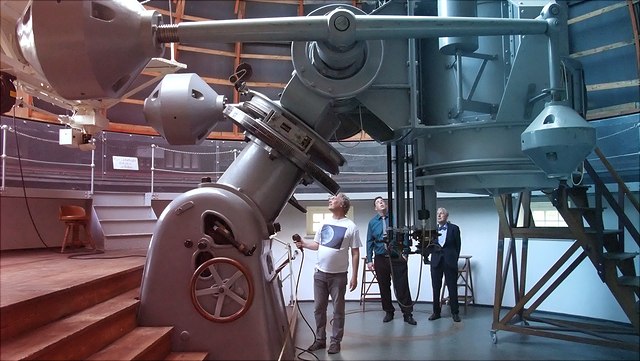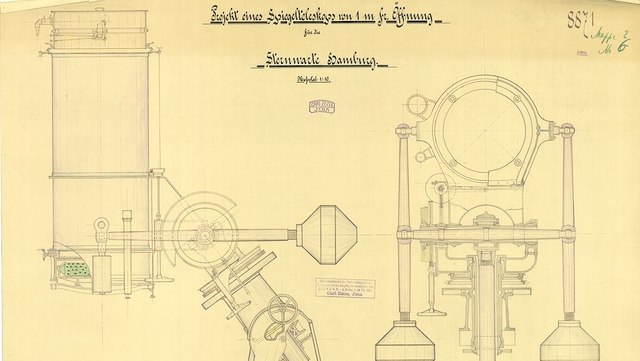Öffentliche Angebote
Der Park der Sternwarte ist täglich von 07.00 bis 22.00 Uhr geöffnet.
Ab Mitte März 2025 bis Ende 2026 werden auf dem Gelände in mehreren Bauabschnitten umfangreiche Bauarbeiten zur Sanierung der Grundsielleitungen stattfinden. Für mögliche Einschränkungen in diesem Zusammenhang bitten wir um Ihr Verständnis!
Sie finden uns auch in der App Kulturpunkte Hamburg.